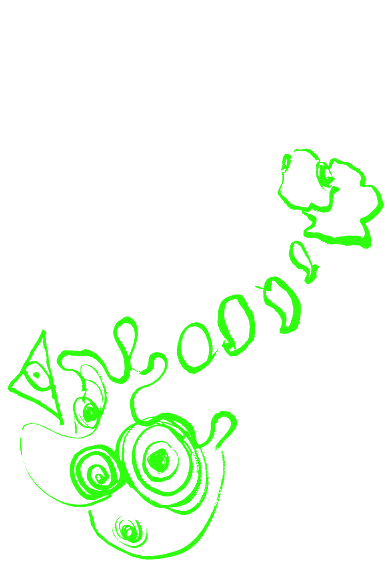Eine kleine Idiotologie des Widerstands
1. Es begann mit einem Gerät
Ein Kopfbügel, der ohne das Ankleben von Elektroden Gehirnströme messen konnte. Ursprünglich konzipiert, um Maschinen per Gedanken zu steuern, offenbarte das Interface bald eine weitere Fähigkeit: Es konnte Veränderungen in der Gehirnaktivität erfassen – ähnlich einem Lügendetektor.
Schnell war die Idee geboren, ganze Räume mit dieser Technologie auszustatten. Gebäude, die als neuronale Scanner fungieren, immer auf der Suche nach Mustern und Frequenzwechseln im Denken ihrer Besucher:innen. Eine dystopische Vision? Vielleicht. Aber eine, die auf Realisierung wartet.
Inspiriert von Hans-Christian Danys Buch Ab morgen werde ich Idiot, stellten wir uns eine zentrale Frage: Wie macht man sich für solche Technologien unsichtbar? Oder schärfer: Wie entzieht man sich der Lesbarkeit?
2. Von der Vermessung zur Verwertung
Es ist ein alter Traum: Gedanken sichtbar machen. Schon der Lügendetektor war ein Versuch, dem Innersten auf die Schliche zu kommen – mit schwitzenden Händen und flatternden Kurven. Heute träumen wir weiter: von Interfaces, die nicht nur Maschinen steuern, sondern Menschen lesen. Maschinen, die erkennen, wann jemand lügt. Oder zweifelt. Oder abschweift. Maschinen, die das Innen nach aussen kehren.
Was dabei oft übersehen wird: Je lesbarer ein Gedanke, desto verwertbarer wird er. Denn Lesbarkeit ist nie neutral. Sie folgt Codes, Normen, Erwartungen – sie macht Verhalten quantifizierbar und damit auch optimierbar. Ein lesbarer Mensch ist ein berechenbarer Mensch. Und damit ein verwaltbarer.
Die Soziologie kennt dieses Phänomen gut. Michel Foucault sprach von der Regierbarkeit des Subjekts – von der subtilen Macht, die nicht mehr auf Verboten basiert, sondern auf Sichtbarkeit. Byung-Chul Han schreibt: Macht erscheint heute als Angebot, nicht mehr als Zwang. Und Shoshana Zuboff erinnert uns: Die Logik des Überwachungskapitalismus will nicht nur wissen, was wir tun – sie will vorhersagen, was wir tun werden. Und letztlich: es steuern.
Was aber, wenn sich das Denken dieser Logik entzieht? Wenn es sich verheddert, verirrt, verschwurbelt? Wenn es keinen Output liefert, keine klare Meinung, kein eindeutiges Profil?
Vielleicht liegt genau darin eine Möglichkeit des Widerstands: im Denken als Rauschen. Als Störung im System. Als idiotischer Glitch.
3. How not to think of a pink elephant
Wir entwickelten eine Installation. Einen Raum. Ein Spiel. Wir nannten es: How not to think of a pink elephant.
Im Zentrum: ein Gedankenkäfig aus Licht. Besucher:innen standen darum herum und studierten eine Anleitung. Die meisten verfielen binnen Sekunden in eine Art innere Rezitation. Einige lachten laut. Über ihren Köpfen: ein sensorgesteuertes Interface, das elektrische Spannungsunterschiede erfasste.
Eine Stimme erklang, ruhig, freundlich, fast beruhigend:
„Bitte denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten.“
Und natürlich dachte jede:r daran.
Ziel war nicht das Gewinnen, sondern das Entgleiten. Die Erfahrung, wie schwer es ist, einen Gedanken nicht zu denken, sobald er als Verbot auftaucht. Und wie leicht sich daraus ein Kontrollmechanismus bauen lässt. Denn wer entscheidet eigentlich, was ein „richtiger“ Gedanke ist?
Ein Besucher sagte beim Verlassen leise:
„Ich habe es kurz geschafft – aber dann dachte ich: jetzt nicht daran denken – und schon war er wieder da.“
Wir notierten das als Erfolg.
4. Strategien des unlesbaren Denkens
Wir begannen zu sammeln: Wege, das eigene Denken zu vernebeln. Nicht aus Angst – aus Lust am Unlesbaren. Aus Freude am Entzug. Eine idiotische Toolbox entstand:
- Selbstunterbrechung: Den Satzfluss stoppen, abbrechen, abbiegen. Wie ein Jazzmusiker, der absichtlich schief spielt.
- Denken in Schleifen: Wiederholen. Wiederholen. Wiederholen. Bis Bedeutung erodiert und Rhythmus bleibt.
- Metaphorisierung: Ein Gedanke ist ein Vogel. Ein Zweifel eine Tangente. Ein Plan eine Pizza.
- Ironie, Zitat, Rollenspiel: Wer denkt hier eigentlich? Ich? Mein innerer Platon? Nur die Nachrede einer Idee?
- Maschinendenken: Texte durch fünf Sprachen jagen. Autokorrektur übernehmen lassen. Chatbots missverstehen.
- Selbstgespräche führen: Laut. In der Küche. In verschiedenen Stimmen. Niemand muss zuhören.
- Sich widersprechen: Im selben Satz, in derselben Haltung. Denken ohne Standpunkt – aber mit Energie.
5. Wir brauchen Idiotie
In der Antike war der idiotes jemand, der sich dem öffentlichen Diskurs entzog. Kein Politiker, kein Rhetoriker. Ein Einzelner. Vielleicht ist es Zeit, diesen Begriff zurückzuerobern.
Nicht als Flucht in das Private, sondern als künstlerischen Akt: die radikale Unsichtbarkeit des Denkens.
Nicht Schweigen. Nicht Protest. Sondern: Denken ohne Signatur.
Ein Denken, das sich nicht lesen lässt – nicht, weil es hohl ist, sondern weil es zu vielschichtig, zu lebendig, zu flüchtig ist.
Wir brauchen keine Klarheit. Wir brauchen keinen Output. Wir brauchen Idiotie.
ss