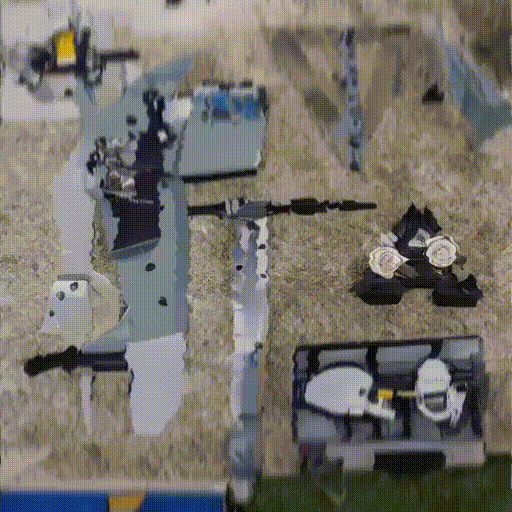Zwischen Notstrom und Nachrichten – wie wir handeln könnten, wenn wir uns trauten.
Ein Essay über Erwartung, Handlung und das Zittern in der Zeit
„Bomben verändern leider die Welt, und noch mehr die Erwartung, dass sie gleich fallen.“
Es ist diese Erwartung, die unsere immer noch behüteten Räume füllt. Nicht der Einschlag, sondern das gespannte Schweigen davor. Nicht die Explosion, sondern die Angst, sie nicht gehört zu haben. Unsere Gegenwart ist durchtränkt von solchen Erwartungsräumen – diffuse Zonen zwischen Wissen und Gerücht, zwischen Faktenlage und Bauchgefühl. Was nun zu tun sei, fragen viele. Doch die eigentliche Frage ist: Wer fragt? Und aus welchem Zustand heraus?
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz innehaltend sagen: Ich sitze gerade auf einem Sessel. Wirklich. Ein gebrauchtes Stück mit hellem Lederbezug, leicht durchgesessen, bequem genug für diesen Text. Ich sitze in Sicherheit, mit Strom,Laptop, Eistee, Reflexion. Und schreibe über Weltlage. Das ist kein Eingeständnis. Es ist ein Kontext.
Wir sind keine Nachkriegsgesellschaft. Wir sind eine Vorkrisengesellschaft im Loop. Wir leben in der Schleife von Ankündigung und Abschwächung, im Pingpong zwischen Alarmismus und Abstumpfung. Der Klimakollaps wird eventuell konkret, die Demokratie eventuell brüchig, der Strom eventuell knapp, der Frieden eventuell vorbei. Wir haben ein Preisschild für jede Möglichkeit – aber keine Haltung mehr zum Preis selbst.
I. Die Illusion der Handlung
Was tun, wenn alles gleichzeitig drängt? Klassisch würde man sagen: priorisieren. Doch das setzt voraus, dass die Krisen voneinander isolierbar sind. Dass wir sagen könnten: „Zuerst das Wasser, dann der Strom, dann die Demokratie.“ Aber das stimmt nicht. Die Krisen hängen ineinander wie ineinandergeschobene Teetassen in der Spüle – sie klirren schon, wenn man nur dran denkt, eine davon anzufassen.
Also tun wir: nichts. Oder alles zugleich. Wir kaufen ein Notstromaggregat und liken gleichzeitig ein Reel über Slow Living in Portugal. Wir posten „Free Palestine“ und bestellen eine neue Powerbank. Wir pflanzen Tomaten auf dem Balkon und denken über Goldreserven nach. Dieses Verhalten ist nicht irrational – es ist sichtbarer Ausdruck einer fragmentierten Weltlage.
II. Erwartung als Zustand
Die Erwartung ist eine eigenartige Kategorie. Sie ist kein Wissen, keine Tat, kein Gefühl – sondern ein Spannungsfeld zwischen dem Jetzt und dem Noch-nicht. Eine Warteposition, in der Körper und Geist permanent aktiviert bleiben, ohne je zur Ruhe zu kommen. Die Folge: Erschöpfung, Gereiztheit, Reizsuche. Der Körper wartet auf die Detonation, das Denken ist längst im Bunker.
In solch einem Erwartungszustand wird nicht mehr geplant – es wird simuliert. Simulation ersetzt Gestaltung. Wir verhalten uns zur Zukunft wie ein Flugsimulator zur Katastrophe: realitätsnah, aber folgenlos. Und so schleichen sich neue Normen ein:
- Es ist normal, ständig mit einem Worst-Case zu rechnen.
- Es ist normal, dabei möglichst ästhetisch auszusehen.
- Es ist normal, empört zu sein und sich moralisch abzusichern – aber bloss nicht zu engagieren.
III. Was also ist zu tun?
1. Den Erwartungsmodus abschalten.
Nicht alles antizipieren. Nicht alles absichern. Wer alles plant, überlässt das Leben dem Algorithmus. In der Kunst: wieder irren dürfen. Im Alltag: Verzicht auf Daueranalyse. „Nicht alles wissen“ kann ein Akt der Befreiung sein.
2. Unwahrscheinliches denken – ohne es zu instrumentalisieren.
Weder Hoffnung noch Angst dürfen zur Marketingstrategie verkommen. Gerade in der Kunst: Räume schaffen, in denen das Unwahrscheinliche ein temporäres Zuhause findet – nicht als Fluchtpunkt, sondern als Möglichkeitsraum.
3. Beziehungen aufbauen, die nicht funktional sind.
Echte Allianzen brauchen Zeit, Zweifel und Friktion. Die künftige Resilienz hängt nicht nur von Technik oder Strategie ab, sondern von der Fähigkeit, komplexe Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch wenn sie nichts „bringen“.
4. Ertragen lernen, dass es keine Garantie gibt.
Das ist vielleicht das Schwerste: Nicht der Angriff ist das Schlimmste, sondern die Ungewissheit, ob er kommt. Die grösste Tat ist manchmal das Warten in Würde. Die Bereitschaft, dem Tag keine Schuld zu geben, auch wenn die Welt in der Nacht wankt.
Postskriptum
Wer heute fragt: Was nun zu tun sei, fragt oft auch: Wozu noch etwas tun? Die Antwort liegt nicht im heroischen Durchhalten, nicht im Rückzug ins Private, auch nicht in zynischer Überlegenheit. Sie liegt in der kleinen, konkreten Geste: Ein Text, der nicht algorithmisch funktioniert. Ein Gespräch, das nicht abbricht, wenn es unbequem wird. Ein Duft, der an etwas erinnert, das niemand messen kann. Jetzt, da die Welt auf ihren eigenen Schatten tritt, braucht es Menschen, die sich nicht ducken, sondern lauschen. Und manchmal ist das, was zu tun ist, nicht mehr als ein sanftes „Ich bin da“.
Beitragsbild: GIF (Auszug) aus «Dispositive against a uncertain future», von «mnemodiot»